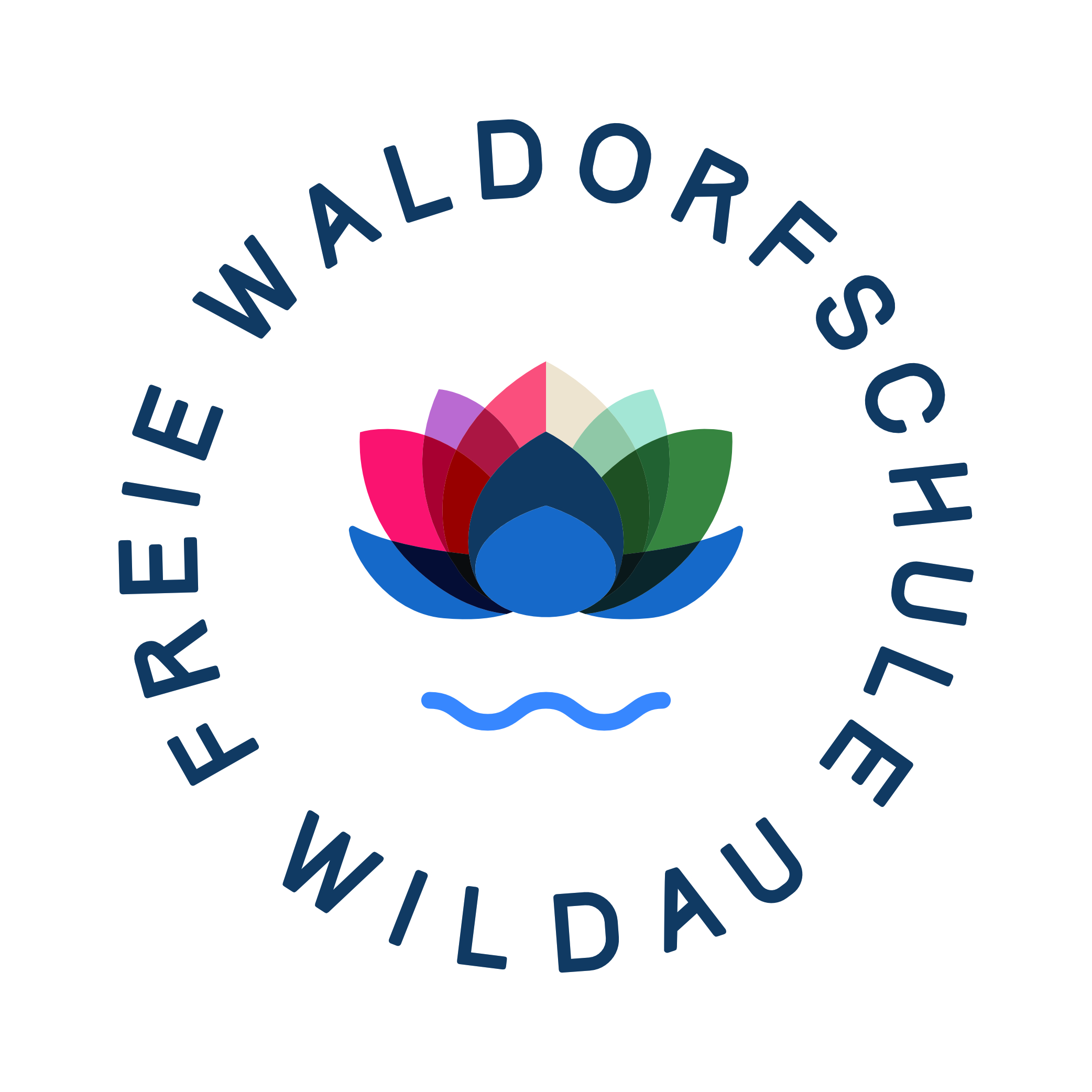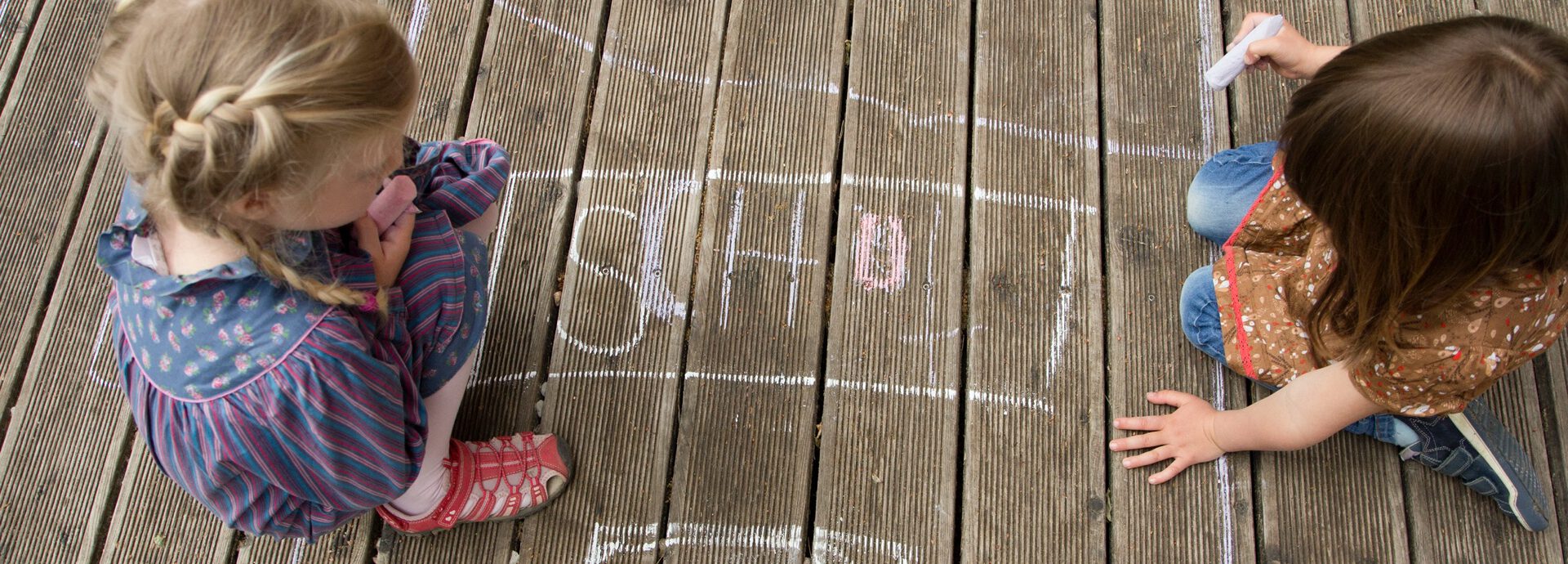Waldorfschule – Überblick
Nach Gründung der ersten Waldorfschule 1919 weist die Waldorfpädagogik heute eine hundertjährige Tradition auf. Weltweit existieren über 1.100 Waldorfschulen. In Deutschland gibt es aktuell mehr als 252 Waldorfschulen, 18 davon in der Region Berlin-Brandenburg.
Waldorfschulen sind Schulen für alle Begabungsrichtungen. Ihr Ziel ist eine ganzheitliche Förderung der kindlichen Entwicklung – also von Körper, Geist und Seele. Die kognitiven, künstlerischen, praktischen und sozialen Fähigkeiten der Kinder werden dabei altersgemäß und in ausgewogenem Verhältnis angesprochen. Dazu bieten Waldorfschulen einige Besonderheiten:
- Die Schule als Gesamtschule von der Einschulung bis zum Erwachsenenalter.
- Stabiler, leistungsheterogener Klassenverband bis zur 12. Klasse.
- Der/die Klassenlehrer*in begleitet möglichst über die ersten acht Jahre hinweg.
- Epochenunterricht am Morgen. Danach Fachunterricht.
- Die individuelle Begleitung der Schüler*innen innerhalb der Klassengemeinschaft.
- Keine Auslese und kein Sitzenbleiben.
- Verzicht auf Noten.
- Zwei Fremdsprachen von der ersten Klasse an (bei uns Englisch und Spanisch).
- Waldorfspezifische Fächer wie Formenzeichnen und die Bewegungskunst Eurythmie.
Waldorf-Schulen sind staatlich anerkannte Ersatzschulen unter freier Trägerschaft. Die deutschen Waldorf-Schulen haben sich als Bund der freien Waldorf Schulen e.V zusammengeschlossen. Die Autonomie der einzelnen Schulen bleibt jedoch unangetastet, wodurch verschiedene Ausrichtungen und Umsetzungen der Waldorf-Pädagogik an unterschiedlichen Schulen entstehen. Die Schulen sind selbstverwaltend. Bei einer wöchentlichen Lehrkräfteversammlung werden organisatorische Aspekte und pädagogische Ausrichtungen besprochen und gleichberechtigt beschlossen. Eine Führung durch eine Direktion, wie es aus staatlichen Schulformen bekannt ist, gibt es nicht.
21 Fragen an die Waldorfschule
Haben Sie noch Fragen? Zum Beispiel diese: Welche Kinder werden an einer Waldorfschule aufgenommen? Worin unterscheiden sich Waldorfschulen überhaupt von anderen Schulen? Ohne Noten und ohne Sitzenbleiben: sind die Kinder dann überhaupt zum Lernen motiviert? Ist Waldorfpädagogik nicht so etwas wie das Vorgaukeln einer heilen Welt? Kommen die Schüler*innen später mit der „harten Realität“ zurecht?
Einige der FAQs an die Waldorfpädagogik hat der Bund hier zusammengefasst und beantwortet.
Antworten auf viele weitere Fragen zur Waldorfpädagogik finden Sie beim Bund der freien Waldorfschulen.
Unterricht an der Waldorfschule
Der Unterricht findet meist fächerübergreifend statt und ist in Schwerpunktthemen, sogenannte „Epochen“, gegliedert. Die Schüler*innen beschäftigen sich über mehrere Wochen mit einer Epoche – in der Grundschule bspw. Rechnen, Lesen/Schreiben, Formenzeichnen. Dabei führen sie ein Epochenheft, worin sie ihren individuellen Lernfortschritt dokumentieren und reflektieren. Die Epochen werden immer in den ersten beiden Stunden am Morgen unterrichtet, danach folgt der Fachunterricht wie Musik, Handarbeit, Eurythmie oder Fremdsprachen.
Während ihrer Schullaufbahn werden die Schüler*innen in den meisten Fächern durchgängig vom Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin unterrichtet. Ab der ersten Klasse lernen Waldorfschüler*innen zudem zwei Fremdsprachen.
Kindgerecht und ganzheitlich
Die Waldorf-Pädagogik möchte ganzheitliches und kindgerechtes Lernen ermöglichen. Ausgerichtet an der kindlichen Entwicklung und kindlichem Lernvermögen werden Inhalte sehr bildlich und kreativ umgesetzt und so erlernt. Rhythmisch gestaltete Lehrtätigkeiten begleiten alle Fächer und Altersklassen. Kognitives Lernen bildet mit aktiven Wahrnehmen und Empfinden eine Einheit und befähigt die Schüler zum nachhaltigen Verstehen des Lernstoffes.
Außerdem üben sich die Waldorf-Schüler*innen in darüber hinausgehenden Fähigkeiten. Kreatives Musizieren soll nach einer Untersuchung des Musikpädagogen Prof. Dr. Hans Günther Bastian nicht nur die musikalischen Fähigkeiten schulen, sondern außerdem die seelische Ausgeglichenheit und Problemlösungskompetenzen fördern. Eine wichtige Säule in der Waldorf-Pädagogik stellt die Eurythmie dar, einem sichtbaren Ausdruck von Musik und Sprache durch tänzerische Bewegungen. Die kreativen Schulinhalte dienen der Entfaltung differenzierter Wahrnehmungsfähigkeiten und der Erschließung schöpferischen Potentials.
Soziale Fähigkeiten fördern
Der Gemeinschaftssinn und die sozialen Fähigkeiten werden durch den immer gleich bleibenden Klassenverband, der von der ersten bis zur zwölften Klasse unverändert bleibt, gestärkt. Ein Sitzenbleiben lernschwacher Schüler gibt es im Waldorf-Schulsystem nicht. Vielmehr werden sehr begabte Schüler wie auch lernschwache Schüler innerhalb des Klassenverbandes gezielt einbezogen und gefördert.
Die zentrale Ansprech- und Vertrauensperson stellt der/die Klassenlehrer*in da, er/sie begleitet den Klassenverband von der ersten bis zur achten Klasse und unterrichtet in dieser Zeit einen Großteil der Fächer. Da in der Waldorf-Pädagogik keine Lehrbücher zum Einsatz kommen, sondern der/die Klassenlehrer*in den Inhalt und die Vermittlung des Lehrstoffes maßgebend bestimmt, gehen seine/ihre Aufgaben weit über die eines/einer Klassenlehrer*in an anderen Schulformen hinaus.
Lernen ohne Noten
Im Gegensatz zu Regelschulen geht es in der Waldorfpädagogik weniger um vergleichbare Schulabschlüsse als um individuelle Lernfortschritte. Einen Leistungsanspruch gibt es trotzdem. Allerdings vereinbaren die Schülerinnen und Schüler an Waldorfschulen gemeinsam mit ihren Lehrkräften eigene Lernziele und dokumentieren bzw. reflektieren ihren Lernfortschritt selbständig. Am Jahresende erhalten alle Schüler*innen ein detailliertes Berichtszeugnis ohne Schulnoten. Ab der neunten Klasse können daneben auch Noten verteilt werden. So werden die Jugendlichen gezielt auf ihre Abschlussprüfungen vorbereitet.
Zukunftskompetenzen von Waldorfschüler*innen
Welche Fähigkeiten bereiten Kinder und Jugendliche auf ihre Zukunft vor? Auf diese Frage gibt es viele unterschiedliche Antworten. Jedoch ist eines gewiss: Deutsch, Mathe, Englisch & Co. allein sind keine ausreichende Vorbereitung auf das Berufsleben und auf die Anforderungen einer globalisierten Welt, in der multiple Krisen und rasante Veränderungen durch die Digitalisierung uns alle herausfordern. Vielmehr brauchen Kinder und Jugendliche einen breiten Fächer an Fähigkeiten, die sie befähigen „selbstständig durch unbekanntes Terrain zu navigieren“. So formuliert es zum Beispiel die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).
Lernen heißt heute mehr, als nur zu wissen. Es heißt, angeeignetes Wissen durch Erfahrungen zu verinnerlichen und auch nachhaltig anwenden zu können. Das hat vor allem mit einer heute stark veränderten Arbeitswelt zu tun, die ganz andere Anforderungen an Schulabgänger*innen stellt als noch vor 30 Jahren. Mehr als reines Schulwissen sind somit Kompetenzen gefragt, mit denen Kinder und Jugendliche ihren eigenen verantwortungsvollen Weg finden und beherzt gehen können. Die Kompetenzen für diesen Weg bilden Kinder an Waldorfschulen aus. Die Schule beantwortet damit den Bedarf an Nachwuchs mit relevanten Zukunftskompetenzen.
Ziel der Waldorfpädagogik ist eine ganzheitliche Förderung der kindlichen Entwicklung – also von Körper, Geist und Seele. Die kognitiven, künstlerischen und praktischen Fähigkeiten der Kinder werden dabei altersgemäß und in ausgewogenem Verhältnis angesprochen. Das Üben sozialer Kompetenzen und das Lernen im gegenseitigen Miteinander in einer stabilen Klassengemeinschaft ist dabei entscheidend. Denn das gemeinsame Lösen von Aufgaben in Gruppen mit unterschiedlichen Begabungen und Kompetenzen ist eine der Herausforderung des Berufslebens und unserer Gesellschaft, worauf die Waldorfschule vorbereiten will.
Ein gelingendes Leben
Was ist ein gelingendes Leben? Am Ende wollen alle Menschen glücklich, gesund und zufrieden sein. Dazu gehören Dinge wie ein erfüllender Beruf, gute Beziehungen zu den Mitmenschen, eine gesunde Familie, finanzielle Sicherheit. Die Waldorfpädagogik möchte bei Kindern und Familien eine nachhaltige Wirkung erzielen im Blick auf eine gelingende Lebensgestaltung – von der Freude am beruflichen Engagement, über Verantwortungsbewusstsein für Gesellschaft und Umwelt bis hin zu positiven Einflüssen auf Lebensführung und Gesundheit im Alter.
Infoabend Waldorfschule Wildau
Wenn Sie Schwerpunkte und Pädagogik an der Waldorfschule Wildau kennenlernen möchten, empfehlen wir den Besuch unserer regelmäßig stattfindenden Informationsveranstaltungen.